Wittenau – Es ist ein sonniger Freitagvormittag, mitten im Monat Ramadan. Auf den Wegen des Flüchtlingsheims, das sich in den westlichen Zipfel des riesigen Geländes der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklink schmiegt, ist kein Mensch zu sehen. Der Spielplatz ist verwaist. Susanna Gebhardt ist seit Februar 2021 die neue Leiterin des Containerdorfes und sagt: „Im Ramadan schlafen viele Bewohner möglichst lange in den Tag hinein. Dann wird gekocht und erst nach Sonnenuntergang darf gegessen und getrunken werden.“ Als erfahrene und studierte Fachkraft im Sozialmanagement bringe ihr die Aufgabe „viel Spaß“ und sie freue sich über ihre „dankbare Arbeit“, mit der sie „Menschen unterstützen kann, die besondere Hilfe brauchen, da sie durch alle Netze zu rutschen drohen.“
Aus dem Container mit den Waschmaschinen tritt ein junger Mann vor die Tür und grüßt Gebhardt freundlich: „Wie geht’s, alles gut?“ Die Leiterin ergreift gleich die Gelegenheit und bespricht mit dem Flüchtling ein paar organisatorische Fragen. Sie ist so etwas wie die Bürgermeisterin in diesem kleinen friedlichen Ort mit den oft grausamen Flüchtlingsschicksalen. In unmittelbarer Nachbarschaft ist die Kältehilfe in einem Gebäude untergebracht. Das Krankenhaus des Maßregelvollzugs für Häftlinge mit Sucht- oder psychischen Problemen ist nicht weit entfernt. Kurz vor Weihnachten öffnete dann das nahe Ankunftszentrum, wo alle nach Berlin kommenden Flüchtlinge durchgeschleust werden.
Sascha Langenbach, der Pressesprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), hat sich zu dem Gang durch das Flüchtlingsheim gesellt. Er spricht von 18.500 Flüchtlingen in 80 Einrichtungen in Berlin. Das Heim in Wittenau ist eine davon. Es hat eine Kapazität für 245 Flüchtlinge. Viele Wohncontainer stehen derzeit leer. Nur etwa 86 Bewohner zählt die Unterkunft, davon sind 33 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die meisten Flüchtlinge kommen aus Moldawien, Syrien, Afghanistan und der Türkei. Bei drei Bewohnern ist die Herkunft nicht zu klären. Die Kinder gehen auf die Peter-Witte- und die Hermann-Schulz-Grundschule.
Ein Container hat 45 Quadratmeter Fläche. Er ist in drei 15 Quadratmeter große Bereiche unterteilt. Rechts und links zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Betten, Schränken und Tischen. In der Mitte Flur, Küche und Badezimmer. Jede Wohneinheit hat freies WLAN. Das ist besonders in Pandemie-Zeiten wichtig für das Home-Schooling und auch für die Verbindung zu den zurückgebliebenen Familienmitgliedern in den Heimatländern. Gebhardt sagt, dass die Bewohner es sehr mögen, „ihren eigenen, abgeschlossenen Bereich“ zu haben. Das Ganze habe einen „Bungalowcharakter“. Vor den Türen sind Blumenkästen, Kinderwagen und Fahrräder.
Gebhardt leitet etwa sieben Mitarbeiter. Der Hausmeister kümmert sich um technische Probleme, bietet aber auch gastfreundlich Kaffee an, als sich Gebhardt und Langenbach zum Gespräch im Büro niederlassen. Die Heimleiterin erzählt von ihrem Team. Der Sozialarbeiter und der Betreuer helfen bei den umfangreichen behördlichen Anforderungen. Fast alle Bewohner streben einen Asylstatus an. Etlichen wird aber nur „subsidärer Schutz“ gewährt. Das heißt, sie dürfen in Deutschland bleiben, weil ihnen in ihrem Herkunftsland „ernsthafter Schaden“ drohe. Andere werden lediglich geduldet, was die „vorübergehende Aussetzung der Abschiebung“ bedeute. 15 Bewohner kämen von den griechischen Inseln, wo sie als Zwischenstation gestrandet waren. Besonders die allein reisenden Kinder bedürften einer erhöhten Fürsorge.
Bei dem Besuch berichten Gebhardt und Langenbach, dass die Impfung der Bewohner gegen das Corona-Virus unmittelbar bevorstehe. Es gelte, viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um Vorurteile gegen die Injektion auszuräumen. Langenbach lobt das bezirkliche Netzwerk „Willkommen in Reinickendorf“, kurz WIR, mit vielen ehrenamtlichen Helfern. bs

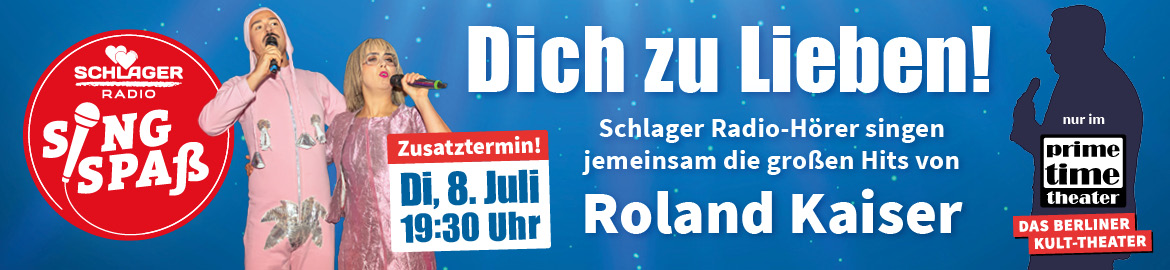




![PTT_NSG_Banner_TopMag_300x250px[1]](https://raz-zeitung.de/wp-content/uploads/2024/10/PTT_NSG_Banner_TopMag_300x250px1.jpg)